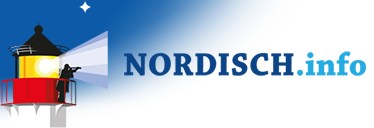Produktivität steigern, Wohlbefinden verbessern
Die Vier-Tage-Woche in Island ist ein voller Erfolg
Island zeigt, dass die Vier-Tage-Woche mehr ist als ein schöner Gedanke. Sie funktioniert – messbar und flächendeckend.
Produktivität steigern und das Wohlbefinden verbessern
Island hatte die verkürzte Woche nicht über Nacht eingeführt. Bereits zwischen 2015 und 2019 liefen zwei große Pilotprojekte im öffentlichen Dienst. Dort arbeiteten rund 2.500 Menschen – mehr als ein Prozent der Erwerbsbevölkerung – nur noch 35 bis 36 Stunden pro Woche. Ziel war es, Produktivität zu halten oder zu steigern und gleichzeitig das Wohlbefinden zu verbessern. Beides gelang.
Zwischen 2020 und 2022 griffen dann 51 Prozent der isländischen Arbeitnehmer das Angebot auf, kürzer zu arbeiten – inzwischen liegt die Zahl wohl noch höher. Die Gewerkschaften verhandelten für Zehntausende Beschäftigte kürzere Arbeitszeiten.
Und was macht die Wirtschaft? Sie boomt. 2023 wuchs Islands Bruttoinlandsprodukt um 5 Prozent – das zweithöchste Wachstum unter den reichen europäischen Volkswirtschaften. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,4 Prozent, weit unter dem EU-Schnitt. Das Autonomy Institute spricht von einem klaren Indikator für die wirtschaftliche Vitalität.
Natürlich dämpft der Internationale Währungsfonds (IWF) die Euphorie etwas. Für 2024 und 2025 wird ein moderateres Wachstum erwartet – unter anderem, weil der Tourismus als wichtiger Treiber schwächer ausfallen dürfte. Auch die Arbeitslosenquote könnte leicht auf 3,8 Prozent steigen. Doch selbst das wäre noch immer eine der niedrigsten in Europa.
International wächst das Interesse an dem Modell. Großbritannien, Irland, Spanien und Deutschland haben bereits eigene Versuche gestartet – mit positiven Rückmeldungen. In Belgien ist die Vier-Tage-Woche sogar gesetzlich verankert.
Island bleibt das stärkste Beispiel dafür, dass weniger Arbeitszeit nicht weniger Leistung bedeutet. Im Gegenteil: Weniger Stunden, mehr Zufriedenheit – und eine Wirtschaft, die trotzdem vorne mitspielt.