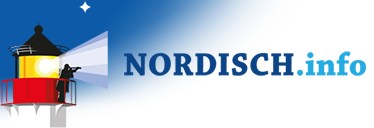Wissenschaftler warnen vor langfristigen Risiken
Entegegen jeder Empfehlung: Schweden will Wolfsbestand halbieren
Die schwedische Umweltschutzbehörde hat auf Anweisung der Regierung den Referenzwert für die Wolfspopulation drastisch gesenkt. Statt bislang 300 Wölfen gilt nun eine Mindestzahl von 170 Tieren als ausreichend, um einen günstigen Erhaltungszustand zu gewährleisten. Tierschützer in Schweden schlagen Alarm: Eine solch starke Reduzierung könnte das Überleben der Wölfe gefährden, sagen sie.

Die Europäische Kommission könnte ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten, sollte Schweden seinen Verpflichtungen aus der EU-Habitat-Richtlinie nicht nachkommen, befürchtet Lind.
EU erwägt schwächeren Schutzstatus
Zusätzliche Sorgen bereitet Naturschützern ein Vorstoß der EU-Kommission: Vergangene Woche wurde vorgeschlagen, den Schutzstatus des Wolfs in der EU-Habitat-Richtlinie von „streng geschützt“ auf „geschützt“ herabzusetzen. Diese Änderung würde die Richtlinie an die Berner Konvention anpassen und könnte dazu führen, dass der Wolf in mehreren Ländern weniger strengen Schutzbestimmungen unterliegt.
„Der Vorschlag kam unscheinbar per Post – ein deutliches Signal, dass der Wolf an Bedeutung verliert“, kritisiert Benny Gäfvert, Raubtierexperte beim WWF. Die Entscheidung könnte gravierende Folgen für die Wolfspopulation haben, insbesondere in Schweden, wo der Bestand durch Inzucht und Lebensraumverluste bereits unter Druck steht.
Wissenschaftler warnen vor langfristigen Risiken
Die schwedische Umweltschutzbehörde hatte bereits 2015 den Referenzwert auf 300 Tiere festgelegt, um eine genetisch überlebensfähige Population zu gewährleisten. Ein zentrales Kriterium war die Einwanderung neuer Wölfe aus dem Osten – mindestens ein Tier alle fünf Jahre.
Nun hat die Behörde auf Wunsch der Regierung erneut eine wissenschaftliche Analyse vornehmen lassen. Die Forscher Nicolas Dussex und Phil Miller kamen zu dem Schluss, dass ein Referenzwert von 170 Wölfen nur unter idealen Bedingungen ausreicht – vorausgesetzt, die Reproduktionsrate bleibt stabil und es wandern alle zehn Jahre bis zu drei neue Tiere ein. Doch in der Realität seien Faktoren wie Inzucht, Krankheiten, illegale Jagd und Lebensraumveränderungen nicht exakt vorhersehbar.
Die Wissenschaftler werfen der Regierung vor, ihre Forschungsergebnisse falsch zu interpretieren.
„Entscheidungen über den Wolf müssen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und rechtsstaatlicher Basis getroffen werden – nicht aus politischen Motiven“, fordert Gäfvert.
Bis Ende Juli muss Schweden den neuen Referenzwert offiziell an die EU melden. Sollte der Wert bei 170 Tieren bleiben, droht ein Konflikt mit der Europäischen Kommission – und möglicherweise eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof.